20.00 Uhr
Weihnachtskonzert des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasiums


Konzerthausorchester Berlin
Joana Mallwitz Dirigentin
Lucas & Arthur Jussen Klavier

Programm
Claude Debussy (1862 – 1918)
„Prélude à l'après-midi d'un faune“ (1894)
Joey Roukens (1982)
„In Unison” – Konzert für zwei Klaviere und Orchester (2017)
Neon Toccata
What if
Dark Ride
PAUSE
Béla Bartók (1881 – 1945)
Konzert für Orchester Sz 116 (1943)
Introduzione
Giuoco delle coppie
Elegia
Intermezzo interrotto
Finale

Seit jeher streben Komponist*innen nach Innovation, wie sich in der Musikgeschichte mal radikaler, mal fließender gezeigt hat. Mit dezidierten Umschwüngen wie einer europäischen Sinfonik nach Beethoven, der Zwölftontechnik des frühen 20. Jahrhunderts oder den ersten elektronischen Elementen der Serialisten wurde stets versucht, Musik neu zu denken, das Gewohnte auf den Kopf zu stellen, teilweise auch zu schockieren. Doch auch die Idee der Rückbesinnung hat seit geraumer Zeit Methode – wie in den parodistischen Übertreibungen des Neoklassizismus oder schlicht direkten Zitaten aus vorangegangen Werken. In diesem Konzert werden drei Komponisten auf die Bühne gebracht, die jeder auf seine Weise Innovation geschaffen haben: Claude Debussy, der für manchen die „moderne Musik“ als solche überhaupt erst erfunden hat; Béla Bartók, der aus teils Jahrhunderte altem Liedgut eine neue Klangsprache entwickelt hat; Joey Roukens, der uns in Echtzeit zeigt, wie vielschichtig Musik im 21. Jahrhundert ist und wie verschiedenste Stile gleichzeitig koexistieren können, ohne sich zu widersprechen. Drei Werke, die als schlagender Beweis dienen könnten, dass das Konzept klassische Musik unerschöpflich ist und weder der Tod eines großen Sinfonikers, die mindestens ebenso vielseitige Populärmusik oder ein alterndes Publikum je ihr Ende bedeuten werden.
Claude Debussys „Prélude à l'après-midi d'un faune“
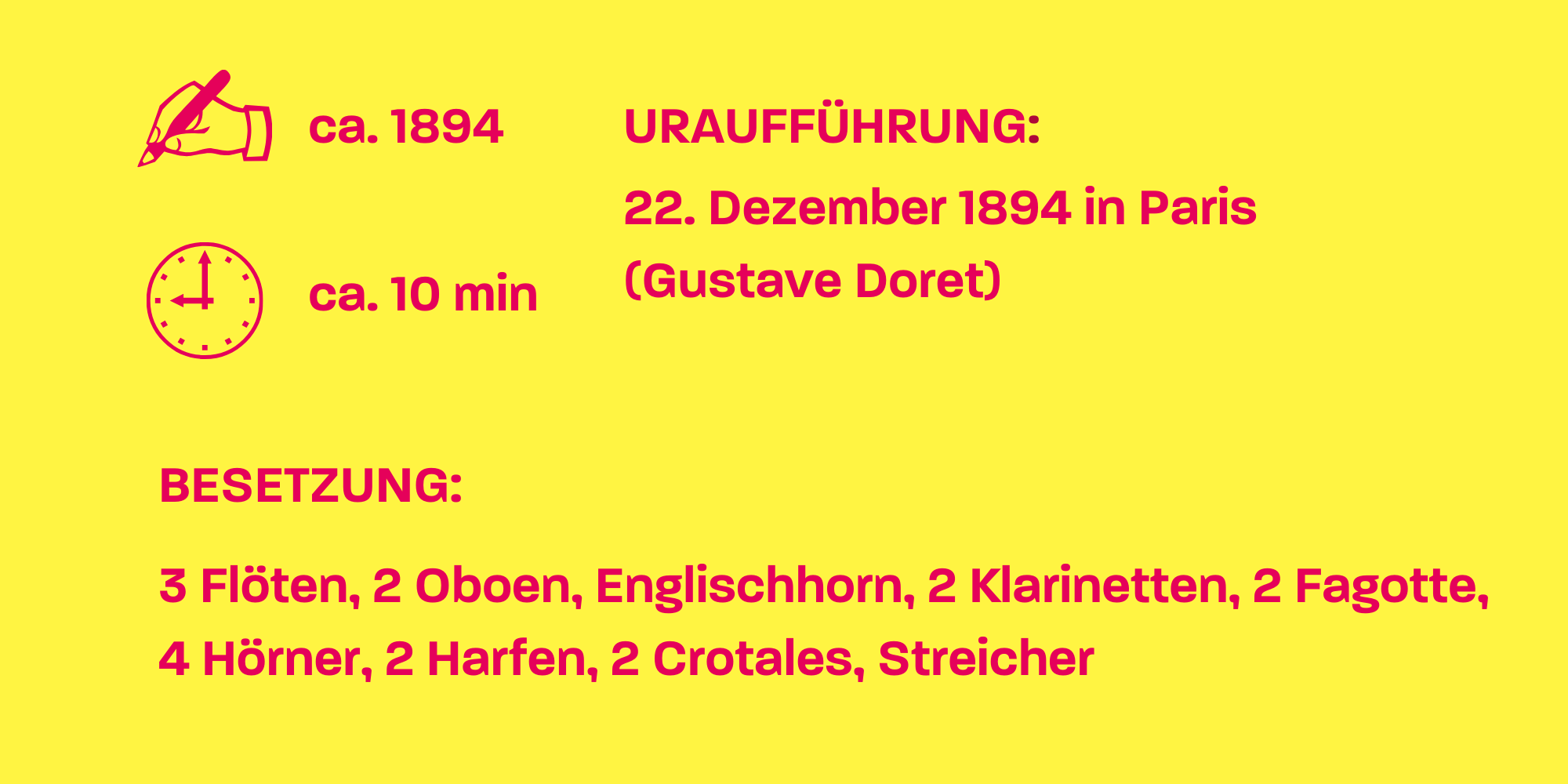

Alles andere als zeitgemäß ist heute der Inhalt von Stéphane Mallarmés Gedicht „L’après-midi d’un faune“, entstanden im Jahr 1865. Es beschreibt den inneren Monolog eines lüsternen Fauns, der nach einem Schläfchen in der heißen Mittagssonne am Fuße des Ätna erwacht und sich versucht, daran zu erinnern, wie er zuvor zwei Nymphen nachgestellt hat, unsicher, ob es nicht nur ein liebestoller Traum war. Mit einer solchen unkritisch geschilderten Geschichte aus Täterperspektive dürfte es heutzutage schwer sein, Leser*innen zu begeistern. Doch bereits damals hatte Mallarmé Probleme, einen Verlag zur Veröffentlichung zu finden. Elf Jahre und mehrere Ablehnungen später wurde sein Gedicht im Jahr 1876 erstmals publiziert und erhielt innerhalb der impressionistischen Künstlergesellschaft positive Resonanz – sein bester Freund, der wegweisende Maler Edouard Manet, bebilderte die Erstausgabe mit vier Holzstichen.
Von anderer Seite wurde dieses Gedicht, wie viele von Mallarmés Werken, als schwer verständlich und symbolisch überladen abgestempelt. So äußerte Marcel Proust: „Wie ärgerlich, dass solch ein talentierter Mann jedes Mal, wenn er einen Stift in die Hand nimmt, wahnsinnig wird.“ Kein Wunder also, dass Mallarmé lieber Menschen um sich versammelte, die seine Werke zu schätzen wussten. So entstand die Künstler*innengruppe „Les Mardistes“ (von mardi, frz. Dienstag), die sich jeden Dienstag in Mallarmés Stube traf, um über Literatur, Musik, Malerei und Philosophie zu plaudern. Zu dieser Gesellschaft gehörten neben Mallarmé und Manet weitere wichtige Persönlichkeiten wie Oscar Wilde, Paul Verlaine, Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin – und schließlich auch Claude Debussy.
Möglicherweise stieß der Komponist an einem dieser Dienstage auf das 110 Alexandriner lange Gedicht über die hormondurchfluteten Tagträume des Fauns, andere Quellen deuten darauf hin, dass Debussy das Werk in einer Zeitschrift entdeckte. Wie dem auch sei: Debussy war sofort hellauf begeistert von dessen schillernder Sprachmelodie und empfahl es 1887 seinem Komponistenkollegen Paul Dukas. Die Idee zu einer eigenen Vertonung kam ihm jedoch erst einige Jahre später. Im Jahr 1890 begann er mit ersten Skizzen zu einem Stück, das zunächst lediglich als Begleitmusik zu einer Lesung des Gedichts herhalten sollte. Zu dieser Lesung kam es jedoch nie, auch vollendete Debussy diese Version des Stücks nicht. Stattdessen plante er, eine dreisätzige Suite, bestehend aus Prélude, Interlude und Paraphrase finale sur l’Après-midi d’un faune zu schreiben, verwarf jedoch auch diesen Gedanken, um letztendlich im Jahr 1894 die 110 Zeilen des Gedichts in exakt 110 Takte Musik umzusetzen.

Trotz der beibehaltenen Satzbezeichnung ist das „Prélude“ ein vollständiges Stück Musik, das sich, entgegen der Idee einer sinfonischen Dichtung, nicht an der literarischen Vorlage entlanghangelt, um eine Handlung zu erzählen, sondern sich vielmehr auf die reinen Stimmungen des Gedichts konzentriert. So schrieb der Komponist selbst: „Die Musik dieses Prélude verbildlicht auf sehr freie Weise Mallarmés schönes Gedicht. Sie macht nicht den Anspruch es nachzuerzählen, vielmehr besteht sie aus einer Reihe von Kulissen, vor deren Hintergrund sich die Begierden und Träume des Fauns in der Hitze dieses Nachmittags bewegen. Ermüdet davon, die furchtsamen Nymphen und scheuen Naiaden zu verfolgen, gibt er sich einem Höhepunkt der Lust hin, zu dem der Traum eines endlich erfüllten Wunsches führt: des vollkommenen Besitzes der ganzen Natur.“ Diese träumerische, erotisch aufgeladene Atmosphäre zeichnet Debussy mit warmen, wabernden Harmonien, angeführt von einer der berühmtesten Flötenmelodien der Musikgeschichte, die sich chromatisch im Rahmen eines Tritonus hin- und herbewegt.
Für viele Musikwissenschaftler*innen markiert dieses Stück den Beginn des musikalischen Impressionismus, für Pierre Boulez ist Debussys „Prélude“ sogar die Initialzündung zur modernen Musik überhaupt: „Seit der Flöte des Fauns atmet die Musik anders“. Debussy selbst bescherte das Stück den kompositorischen Durchbruch, gegen die Bezeichnung als Impressionist wehrte er sich jedoch sein ganzes Leben: „Ich versuche etwas Neues zu erschaffen – sozusagen Wirklichkeiten: das, was die Dummköpfe Impressionismus nennen. Ein Ausdruck, der unpassender nicht sein könnte.“
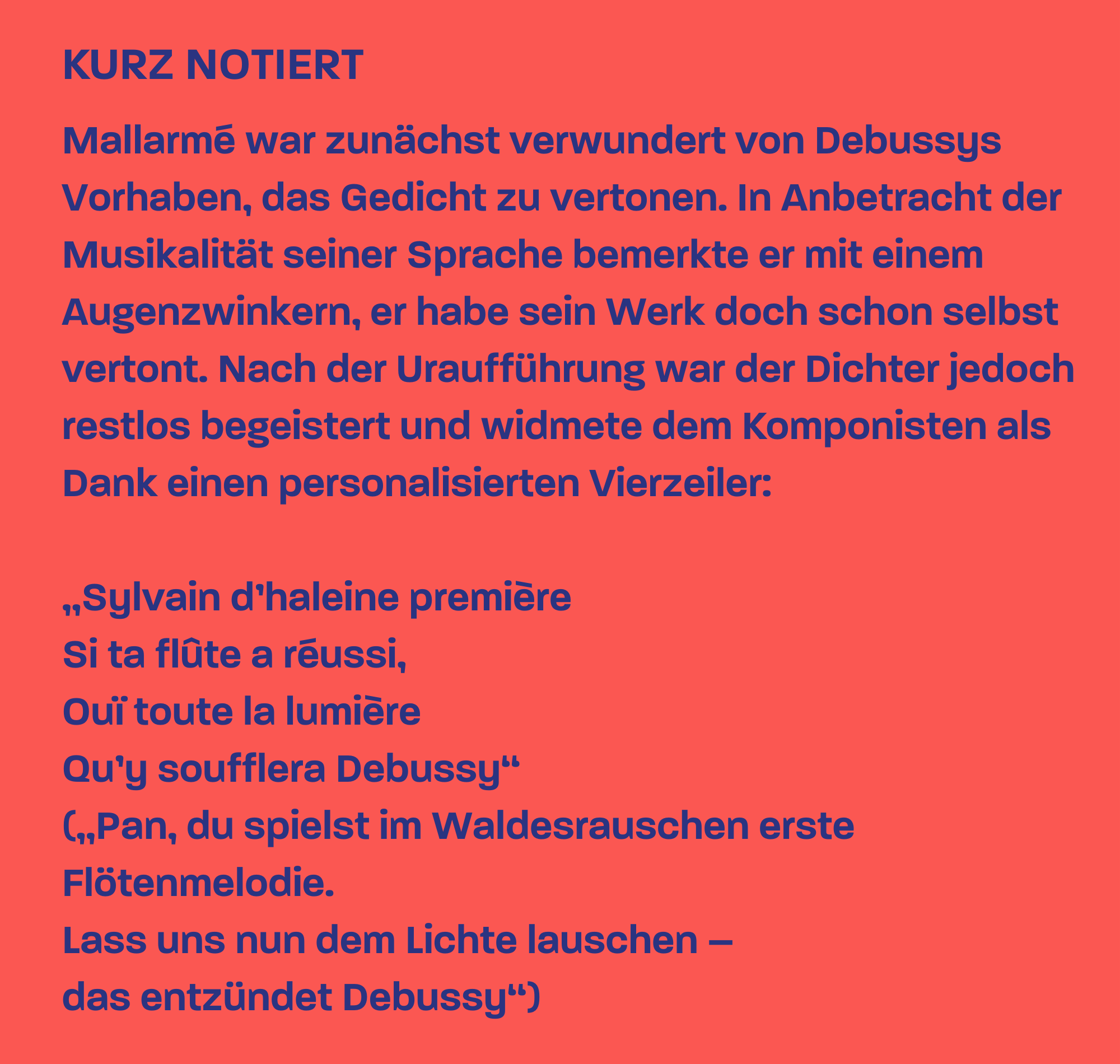 zurück
zurück
Joey Roukens‘ Konzert für zwei Klaviere und Orchester


Joey Roukens ist einer der spannendsten niederländischen Komponisten der Gegenwart. Mit seinem eklektischen, ganzheitlichen Ansatz, Musik verschiedenster Provenienz zu vereinen – sei es tonal und atonal, populär und klassisch oder eine Mischung verschiedener kultureller Einflüsse – steht er in der Tradition Bela Bartóks. Doch sein Werk „In Unison – Konzert für zwei Klaviere und Orchester“ ist kein herkömmliches Konzert: „Nach und nach entstand die Idee, ein Doppelkonzert zu schreiben, in dem die beiden Solisten nicht so sehr wie zwei getrennte Solisten, sondern gewissermaßen wie ein Superpianist auf einem Superpiano klingen sollten, was bedeutet, dass es viele Unisono-Passagen gibt“, schreibt Roukens selbst über sein Werk. Inspiration dafür schöpfte er aus Aufnahmen von Lucas und Arthur Jussen, die ihn mit ihrem perfekt aufeinander abgestimmten Spiel so begeisterten, dass er ihnen er das Werk daher widmete.
Das Konzert beginnt mit einer treibenden, grellen Toccata. Roukens nutzt darin Harmonien, die er mit „neonfarbener“ Popmusik assoziiert. Herzstück des Konzerts ist der langsame Mittelsatz, der von pulsierenden Tonrepetitionen und ätherischen Klangfarben lebt, die einen cineastischen Ausbruch einrahmen. Das Finale, von Roukens als, düsterer, wahnsinniger Ritt bezeichnet, erinnert in seiner perkussiven Gewalt zeitweise an Schostakowitsch. In einer Art Todestanz teilen sich in einer brodelnden Passage kurz vorm Ende nur noch die beiden Klaviere mit der Pauke die Bühne, bevor das Orchester noch einmal zum letzten Schlag ausholt.
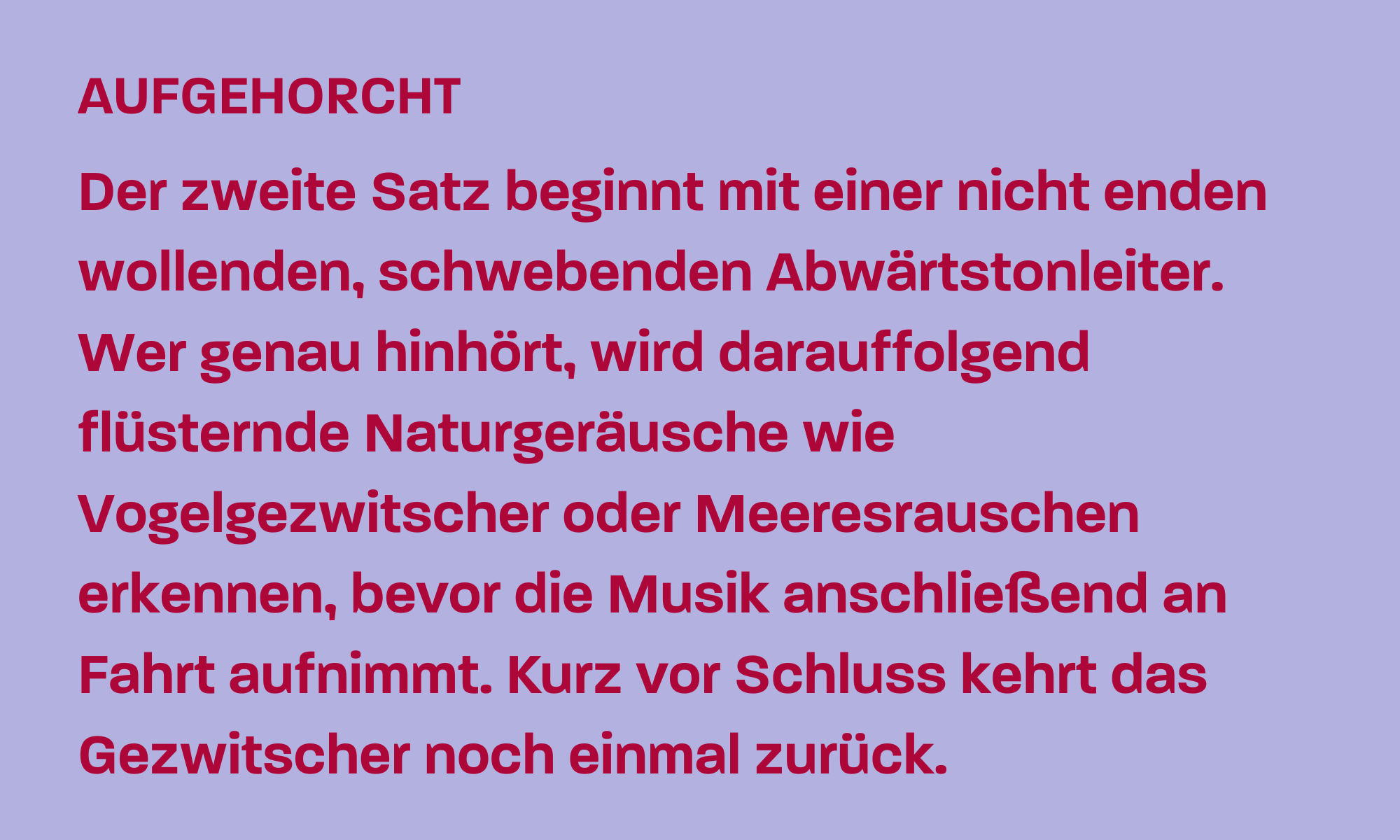 zurück
zurück
Béla Bartóks Konzert für Orchester
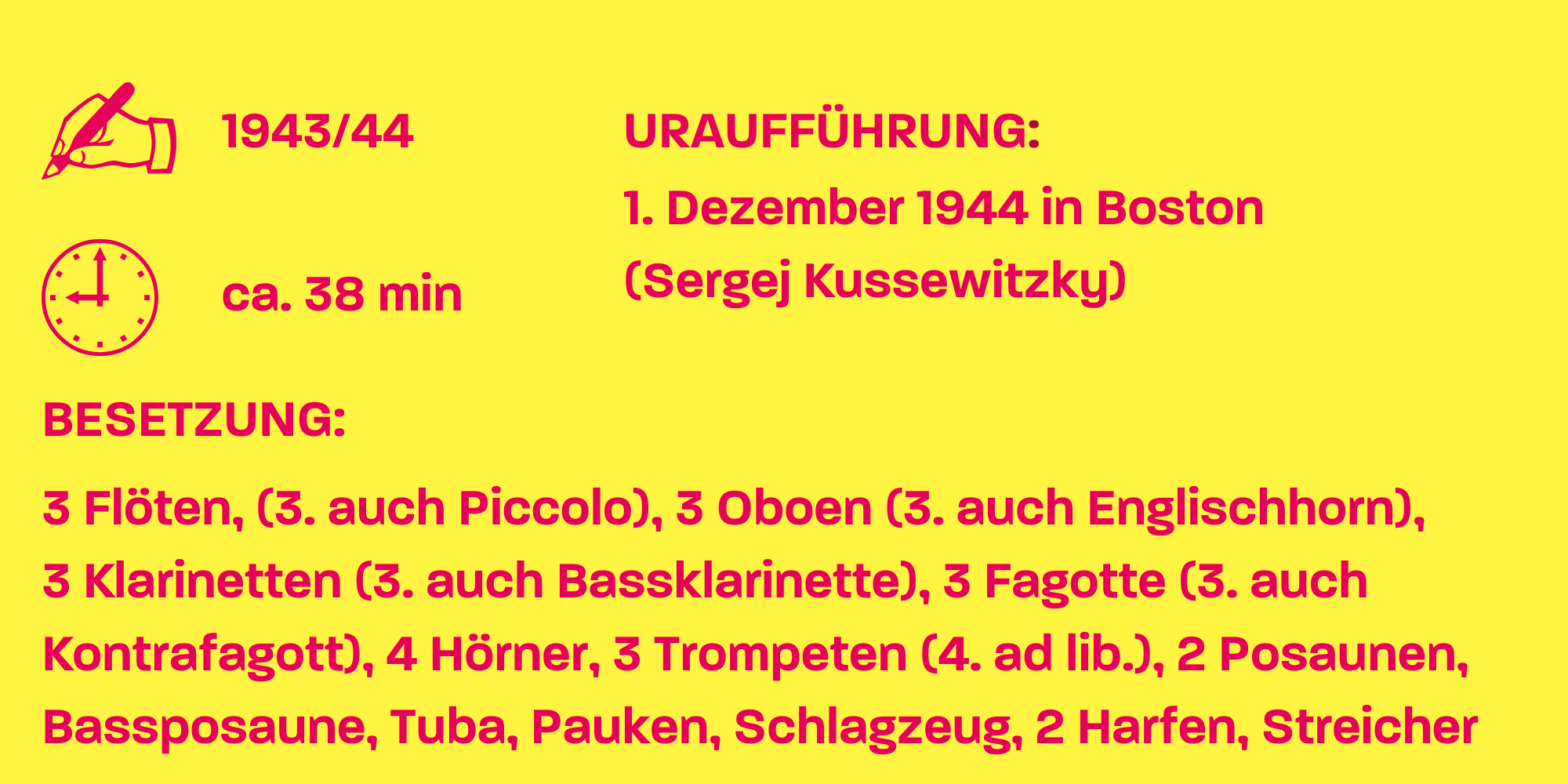

Im Gegensatz zu Debussy, der mit seinem „Prélude“ seine Karriere erst so richtig in Fahrt brachte, entstand Béla Bartóks „Konzert für Orchester“ am mutmaßlichen Tiefpunkt seiner kompositorischen Laufbahn. Lange haderte der Komponist mit der Idee der Emigration, schließlich ließ er doch im Jahr 1940 seine vom deutschen Faschismus bedrohte ungarische Heimat zurück. In Europa hatte sich der Komponist mit seiner von volkstümlichen Einflüssen geprägten Klangsprache schnell einen Namen gemacht. Bartók zeigte früh reges Interesse an dem folkloristischen musikalischen Reichtum seines Heimatlandes, im Gegensatz zu vorangegangen Werken wie Brahms‘ Ungarische Tänze oder Liszts Ungarische Rhapsodien war ihm jedoch daran gelegen, die Volksmusik nicht in ein romantisches Gewand zu kleiden, sondern sie in ihrer Reinform als Grundlage zur Entwicklung eines neuen Klangidioms zu nutzen.
Dazu gehörten auch die für europäisch-klassisch geprägte Ohren ungewohnten Tonalitäten und ungeraden Rhythmen, mit denen Bartók zwar auf Begeisterung, aber auch auf Probleme bei der Ausführung der Musiker*innen stieß. Denn Bartók ließ verschiedene Tonarten gleichzeitig ablaufen, reihte mit ständigen Taktwechseln alte Tanzrhythmen aneinander und entwickelte so einen eigenen, unverwechselbaren Stil. Ein ähnliches Vorgehen findet sich in vielen Werken Igor Strawinskys wieder, der beispielsweise für sein Ballett „Le sacre du printemps“ tief in die teils Jahrhunderte alte Volksmusik seines eigenen Heimatlandes eintauchte. Mit seiner Synthese aus Alt und Neu entwickelte Bartók gleichzeitig ein Gegenentwurf zur Zwölftontechnik der Zweiten Wiener Schule, die ihrerseits versuchte, mit komplett neuartigen Klängen die Romantik hinter sich zu lassen und das angelaufene 20. Jahrhundert zu prägen.
Diese erfolgreiche Karriere nahm jedoch mit dem Zweiten Weltkrieg eine Wendung, als Bartók sich schließlich gezwungen sah, seine Heimat zu verlassen und nach New York überzusiedeln. Dort war er weitestgehend unbekannt und erhielt kaum Aufträge, wodurch sich seine finanzielle Lage schlagartig verschlechterte. Zusätzlich fühlte sich der Komponist im Dauerlärm Manhattans unwohl und konnte daher ganze drei Jahre überhaupt keine Musik zu Papier bringen. Zu allem Überfluss erkrankte er unheilbar an Leukämie, was ihn zunehmend schwächte.
Das Jahr 1943 brachte endlich einen lukrativen neuen Kompositionsauftrag: Der Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra Sergej Kussewitzky erschien persönlich an Bartóks Krankenbett und bot ihm 1000 Dollar für ein Werk für Orchester, außerdem wurde ihm eine Behandlung für seine Krebserkrankung ermöglicht. Bartók lehnte zunächst ab, da er befürchtete, er würde das Stück aufgrund seines rapide sich verschlechternden Gesundheitszustands nicht vollenden können. Daher ist es beinahe unglaublich, dass mit dem Konzert für Orchester unter diesen äußerst widrigen Umständen seine bis heute berühmteste und erfolgreichste Komposition entstand. In einem Anflug von neu entfachter Energie stellte Bartók das Konzert innerhalb von drei Monaten fertig, ein knappes Jahr später wird es im Dezember 1944 in Boston uraufgeführt – der Erfolg ist durchschlagend.
Diese denkwürdige Entstehungsgeschichte, aus dem Krankenbett eines Todgeweihten bis in den jubelnden Konzertsaal, schlägt sich in der Entwicklung des fünfsätzigen Werks nieder. Bartók selbst schrieb über sein Stück: „Abgesehen von dem scherzhaften zweiten Satz verwirklicht das Werk im Ganzen den stufenweisen Übergang von der Finsternis des traurigen Klagegesangs des ersten und dritten Satzes zur Lebensbejahung des letzten“. Obwohl man das Stück in seiner formalen Anlage daher auch als Sinfonie bezeichnen könnte, wählte Bartók bewusst den Titel „Konzert für Orchester“, um zu unterstreichen, dass die einzelnen Instrumente und Register des Klangkörpers solistischer agieren, als es in einer Sinfonie der Fall wäre. So lassen sie sich mal abwechselnd gegenseitig den Vortritt, während der Rest als Begleitung fungiert, mal finden verschiedene Soloeinwürfe gleichzeitig statt. Der erste Satz schwankt zwischen atmosphärischen Lamenti und panischen Ausbrüchen. Im folgenden Giuoco delle coppie (dt. „Spiel der Paare“) wird der solistische Charakter besonders deutlich, nacheinander treten paarweise die verschiedenen Instrumentengruppen auf, die jeweils um unterschiedliche feste Intervalle versetzt tänzelnde Themen vortragen und eine kleine, groteske Pause von Bartóks auskomponiertem Schmerz bieten. Dieser klingt im dritten Satz erneut an, nach geheimnisvollem Flirren kollabiert die Musik immer wieder, es bleibt eine nervöse Spannung übrig. Der kurze vierte Satz beginnt als ironisch-romantischer Tanzverschnitt und mündet in einen massiven Seitenhieb auf Dmitri Schostakowitsch. Bartók nimmt das markante Marschthema aus dessen siebter Sinfonie und setzt es so überdreht um, dass man glaubt, das Orchester spöttisch lachen hören zu können. Daher ist es verwunderlich, dass das turbulente Finale in einzelnen Streicherpassagen durchaus an Bartóks ungeliebten Kollegen erinnert. Auch hier offenbart sich mit ständig wechselnden Soli noch einmal deutlich, weshalb der Komponist sein Stück nicht als Sinfonie bezeichnet hat.
Das Konzert für Orchester sollte Bartóks letztes großes vollendetes Werk bleiben; er verstirbt weniger als ein Jahr nach der Uraufführung am 26. September 1945 in New York City. Seine Heimat hat er nie wiedergesehen.
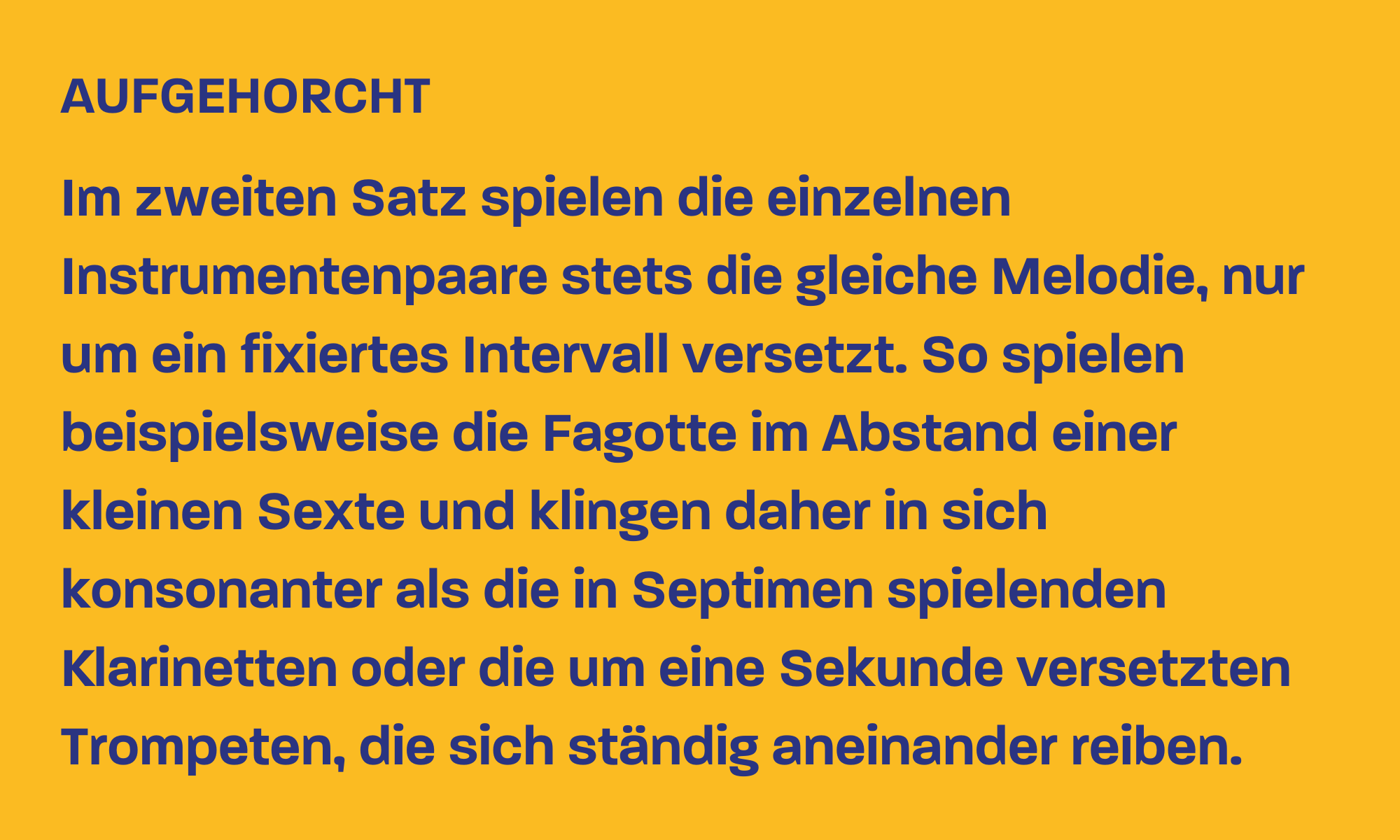



Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.
1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.
Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Seit der Saison 2023/24 ist Joana Mallwitz Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin.
Spätestens seit ihrem umjubelten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts „Cosi fan tutte“ zählt Joana Mallwitz zu den herausragenden Dirigent*innenpersönlichkeiten ihrer Generation. Ab 2018 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig, wurde sie 2019 als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war sie an der Nationale Opera Amsterdam, dem Opera House Covent Garden, an der Bayerischen Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Royal Danish Opera, der Norwegischen Nationaloper Oslo und der Oper Zürich zu Gast.
Konzertengagements führten sie zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, HR- und SWR-Sinfonieorchester, den Dresdner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, den Münchner Philharmonikern, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und den Göteborger Symphonikern und als Porträtkünstlerin zum Wiener Musikverein.
Nach ihrem langjährigen Engagement als Kapellmeisterin am Theater Heidelberg trat Mallwitz zur Spielzeit 2014/2015 als jüngste Generalmusikdirektorin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. Dort rief sie die Orchester-Akademie des Philharmonischen Orchesters ins Leben und begründete das Composer in Residence-Programm „Erfurts Neue Noten“. Ihre ebenfalls in dieser Zeit konzipierten „Expeditionskonzerte“ wurden auch am Staatstheater Nürnberg und als Online-Format ein durchschlagender Erfolg.
In Hildesheim geboren, studierte Joana Mallwitz an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue sowie Klavier bei Karl-Heinz Kämmerling und Bernd Goetzke.
Joana Mallwitz ist Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens und des Bundesverdienstkreuzes. Sie lebt mit Mann und Sohn in Berlin.
In ihrer Debütsaison 2023/24 nahm Joana Mallwitz mit dem Konzerthausorchester Berlin Werke von Kurt Weill auf. Sie erschienen vor kurzem bei Deutsche Grammophon, wo die Chefdirigentin Exklusivkünstlerin ist. Im Frühsommer 2024 kam „Momentum“, ein Dokumentarfilm von Günter Atteln über ihren Weg ans Konzerthaus Berlin, in die Kinos.

Arthur & Lucas Jussen gehören zu den gefragtesten Klavierduos unserer Zeit. Angesichts ihrer glänzenden internationalen Karriere kann man sagen, dass die Brüder Jussen (geb. 1993 und 1996) Hollands bekannteste Botschafter in Sachen klassische Musik sind. Zurückliegende Engagements führten sie zu Orchestern wie dem Boston Symphony Orchestra, The Philadelphia Orchestra, Concertgebouworkest, Budapest Festival Orchestra, NDR Elbphilharmonie Orchester und der Academy of St Martin in the Fields. Sie arbeiteten mit vielen namhaften Dirigenten zusammen, darunter Christoph Eschenbach, Iván Fischer, Sir Neville Marriner, Andris Nelsons, Yannick Nezét-Séguin, Jukka-Pekka Saraste und Jaap van Zweden.
In der Saison 2024/2025 sind die Brüder Jussen Artists in Residence des Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Zu den Höhepunkten der neuen Spielzeit gehören darüber hinaus Konzerte in Leipzig sowie eine anschließende Europatournee mit dem Gewandhausorchester. Neben ihren Debüts beim Chicago Symphony Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic, Göteborgs Symfoniker und Israel Philharmonic bringen die Jussens gemeinsam mit dem brasilianischen Jugendorchester „Neojiba“ Osvaldo Golijovs „Nazareno” bei Konzerten in Deutschland, Italien und den Niederlanden zur Aufführung. Im Rezital sind sie u.a. in Paris, Amsterdam, Oslo, London, Rom, Neapel, Zürich, Mannheim und Stuttgart zu hören.
Seit 2010 sind Lucas & Arthur Jussen beim Label Deutsche Grammophon unter Vertrag. Nach einem Schubert-Album und „Jeux”, einer Aufnahme mit französischer Klaviermusik, erschien 2015, begleitet von der Academy of St Martin in the Fields und Sir Neville Marriner, ein Album mit den Mozartkonzerten KV 242 und KV 365. 2019 veröffentlichten die Jussen-Brüder, begleitet von der Amsterdam Sinfonietta, eine Aufnahme mit Konzerten und Chorälen von Johann Sebastian Bach. Auf „The Russian Album” (2021) interpretieren sie Werke für zwei Klaviere von Rachmaninow, Strawinsky und Arensky. In ihrer jüngsten Einspielung „Dutch Masters” (2022), unterstützt u.a. vom Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, widmen sie sich Werken holländischer Komponisten.

