20.00 Uhr
Weihnachtskonzert des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasiums


Vogler Quartett
Tim Vogler Violine
Frank Reinecke Violine
Stefan Fehlandt Viola
Stephan Forck Violoncello
Martin Spangenberg Klarinette
Joseph Haydn (1732 – 1809)
Streichquartett F-Dur op. 77 Nr. 2 Hob III:82
Allegro moderato
Menuet. Presto – Trio
Andante
Finale. Vivace assai
Sarah Nemtsov (*1980)
„im Andenken“, nach dem Fragment des Andante aus dem Streichquartett c-Moll D 703 von Franz Schubert
Pause
Max Reger (1873 – 1916)
Quintett A-Dur für Klarinette, zwei Violinen, Viola und Violoncello op. 146
Moderato ed amabile
Vivace – Un poco meno mosso
Largo
Poco allegretto (Thema mit Variationen)
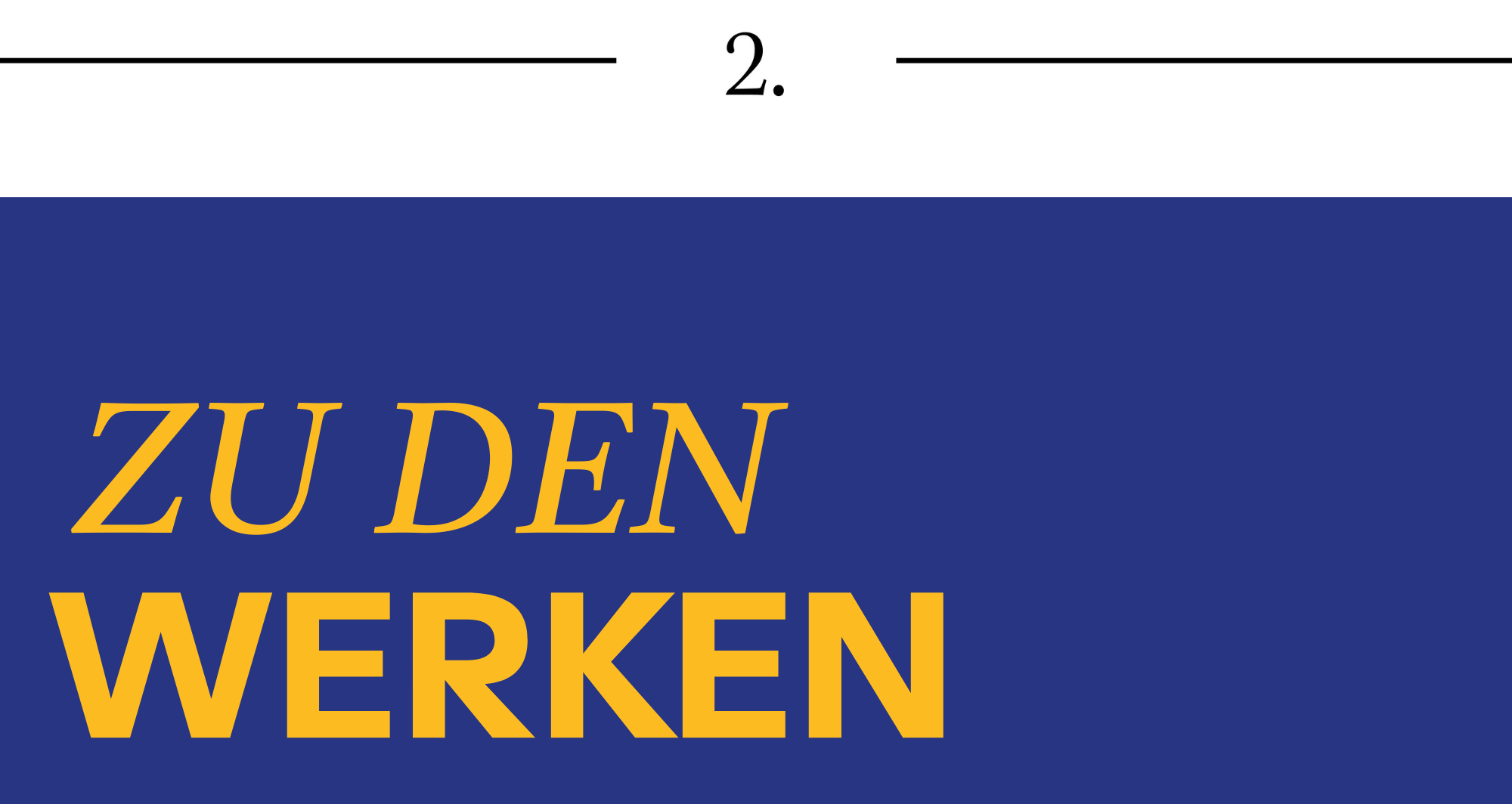
Haydns F-Dur-Quartett op. 77 Nr. 2
Joseph Haydn komponierte sein F-Dur-Quartett op. 77 Nr. 2 1799 als sein letztes vollendetes Werk der Gattung. Danach schrieb er drei Jahre später lediglich noch die beiden mittleren Sätze eines d-Moll-Quartetts, das er nicht mehr zu Ende bringen sollte. Ludwig Finscher rühmte die „Einfachheit höheren Grades“ in diesem Werk; Stefan Kunze sprach von einer überlegenen Freiheit beim späten Haydn, bei der „in jedem Takt alles Verfahrensmäßige ausgeschaltet bleibt“.
Wenn Haydn im Kopfsatz das Seitenthema vom Hauptthema begleiten lässt, so hebt er die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenstimme letztlich auf. In der Durchführung treibt er die thematische Arbeit mit Motiven des Hauptthemas auf einen Höhepunkt innerhalb der Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts hin. Indem er den Dreiertakt im Menuet durchgängig konterkariert, wollte er womöglich Beethovens frühe Scherzi an Radikalität überbieten. Allein das in Des-Dur stehende Trio stellt einen Ruhepol zu dieser Presto-Raserei dar. Das Herzstück des Quartetts bildet der langsame Satz, den Haydn, wohl um ihn von den übrigen Sätzen abzugrenzen, aus D-Dur nimmt. In ihm hat er zwei Formen klassischer Instrumentalmusik, die Variationenfolge und die Sonatenform, miteinander verschränkt. Das Thema selbst wäre vielleicht am besten mit dem Paradox „sanfter Marsch“ charakterisiert. Veränderungen nimmt Haydn aber vor allem in den Zwischenspielen vor. Mit einem Sonatenrondo wird das Quartett beschlossen. Doch recht eigentlich fehlt es in ihm an einem plastischen Thema.
Sarah Nemtsovs „im Andenken“
Sarah Nemtsov, geboren 1980 in Oldenburg, begann mit acht Jahren eigene Stücke zu schreiben und studierte Komposition bei Nigel Osborne und Johannes Schöllhorn in Hannover, daneben auch Oboe. Zudem war sie Meisterschülerin bei Walter Zimmermann an der Universität der Künste Berlin. Sie lehrte als Gastdozentin an der Musikhochschule Köln und im Rahmen einer DAAD-Dozentur an der University of Haifa, Israel. Seit 2022 unterrichtet sie als Professorin für Komposition an der Universität Mozarteum Salzburg. Ihr Werkverzeichnis umfasst über 150 Kompositionen verschiedener Gattungen, in denen unterschiedliche Einflüsse, die von der Renaissance- und Barockmusik bis hin zu Jazz und Rock und elektronischer Musik reichen, miteinander verbunden sind. Sarah Nemtsov hat zahlreiche Kompositionspreise erhalten.
Zu ihrer Komposition „im Andenken“, nach dem Fragment des Andante aus Schuberts Streichquartett c-Moll D 703, schreibt sie, dass sie sich bereits 2002 kompositorisch mit einem Fragment Schuberts, dem Lied „Johanna Sebus“ D 728 beschäftigt habe. „Damals entschied ich mich für einen radikalen Bruch zwischen den musikalischen Sprachen – was an der ‚Schnittstelle‘ mit gesprochenen statt gesungenen Worten verdeutlicht wurde. Bei ‚im Andenken‘ ging ich einen anderen Weg. […] Das Bezugnehmen bestand dann etwa darin, dass ich Schuberts allgemeine kompositorische Prinzipien sowie die in dem Fragment angelegten Elemente abstrahierte, um sie als Bausteine für mein eigenes Schreiben zu verwenden.“ Es geht ihr um „die Thematisierung von Nähe und Ferne: Es ist doch so, dass die Musik Schuberts uns heute als das Vertraute erscheint, wenngleich sie mit ihrem historischen Kontext weit entfernt von uns sein müsste und vielmehr das Zeitgenössische, das Aktuelle Nähe aufweisen sollte. (Gleichzeitig werden bekanntlich die Meister ob der ‚Zeitlosigkeit‘ ihrer Werke als solche gerufen.) Zuletzt erklingt daher der Beginn des Schubertschen Fragments ‚con sordino’ und fast doppelt so langsam gespielt – der Zeit entrückt, von Ferne.“
Die Komposition ist im Auftrag der Musiktage Hitzacker 2007 entstanden und wurde am 14. Juni 2008 durch das Nomos-Quartett in Hannover uraufgeführt.
Regers Klarinettenquintett A-Dur
Sein im Sommer 1915 begonnenes Klarinettenquintett ist Max Regers letzte vollendete Komposition. Er erlag im Mai 1916, kurz nachdem er das Manuskript an seinen Verleger geschickt hatte, einem Herzschlag. Reger orientiert sich in seinem Opus 146 zwar unüberhörbar an den beiden Quintetten von Mozart und Brahms, doch lässt er im Unterschied zu diesen Vorbildern die Klarinette zumindest im Kopfsatz, einem Sonatensatz mit zwei Themen, nicht solistisch, als von den Streichern abgesetzte Stimme hervortreten, sondern komponiert ein gleichberechtigtes Gespräch der fünf Instrumente. Regers Tempo-Bezeichnung lautet „Moderato ed amabile”, also: gemäßigt, mit Liebe. Im motivisch überschaubar komponierten, wendig, dahinhuschenden Scherzo dagegen lässt Reger die Legatobögen der Klarinette vom Bratschen-Staccato und dem gedämpftem Pizzicato der anderen Streicher begleiten. Im Trio gibt er der Klarinette eine ländlerhaft wiegende Melodie. Das Largo, in dreiteiliger Liedform und Ruhepol im Quintett, beginnt mit einem Gesang der Klarinette. Zweimal kehrt das Seitenthema aus dem ersten Satz wieder. Das Finale ist Regers letzter Beitrag zu der von ihm so hoch geschätzten Spezies der Variationenfolge. Zu dem von ihm selbst erfundenen, gesanglichen und ungewöhnlich ausgedehnten „Grazioso”-Thema schieb Reger acht kunstvolle Variationen.
Uraufgeführt wurde Regers Klarinettenquintett im November 1916 bei einer Gedenkfeier für den Komponisten in Stuttgart.



Das Ensemble, das seit 1985 in unveränderter Besetzung spielt, wurde bereits ein Jahr nach seiner Gründung an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin mit dem Ersten Preis beim Streichquartettwettbewerb in Evian 1986 international bekannt. Eberhard Feltz, György Kurtág und das LaSalle Quartett, hier vor allem Walter Levin, förderten das Quartett und wurden zu prägenden Mentoren. Sein umfangreiches Repertoire reicht von Haydn über Bartók und die Zweite Wiener Schule bis zu Neuer Musik. So spielte es unter anderem die Werke von Karl Amadeus Hartmann sowie das mehrstündige Quartett Nr. 2 von Morton Feldman, realisierte zusammen mit dem Arditti Quartett einen Rihm-Zyklus zur EXPO 2000 und brachte Kompositionen beispielsweise von Moritz Eggert, Frank Michael Beyer, Ian Wilson, Jörg Widmann, Mauricio Kagel, Erhard Grosskopf, Taner Akyol und Sven-Ingo Koch zur Uraufführung. Regelmäßig arbeitet das Vogler Quartett mit Künstlern wie Jörg Widmann, David Orlowsky, Salome Kammer, Jochen Kowalski, Tatjana Masurenko oder Oliver Triendl zusammen. In der Vergangenheit konzertierte es unter anderem auch mit Lynn Harrell, James Levine, Bernard Greenhouse, Boris Pergamenschikow und Menahem Pressler.
In den europäischen Musikzentren fühlen sich die vier Musiker ebenso zu Hause wie in den USA, Japan, Australien und Neuseeland. Seit 1993 veranstaltet das Vogler Quartett im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt eine eigene Konzertreihe, seit 2000 ebenfalls in Neubrandenburg. 2000 gründete das Ensemble das jährlich stattfindende Kammermusikfestival „Musik in Drumcliffe“ im irischen Sligo und übernahm 2002 die künstlerische Leitung der Kammermusiktage Homburg/Saar. Die Mitglieder des Vogler Quartetts unterrichten an den Hochschulen in Berlin, Frankfurt, Leipzig und Stuttgart und geben Meisterkurse für professionelle Quartette in Europa und Übersee. Als Nachfolger des Melos-Quartetts hatte das Vogler Quartett die Professur für Kammermusik an der Musikhochschule in Stuttgart inne. Im Bereich der Musikvermittlung ist es bei „Musik in Drumcliffe“ und seit 2005 bei den mehrfach ausgezeichneten Nordhessischen Kindermusiktagen tätig.
Anlässlich des 30-jährigen Quartettjubiläums erschien Anfang 2015 im Berenberg Verlag das Buch „Eine Welt auf sechzehn Saiten – Gespräche mit dem Vogler Quartett“. Die Diskographie des Ensembles umfasst Werke unter anderem von Brahms, Schumann, Schubert, Mendelssohn, Reger, Schulhoff, Hartmann, Klarinettenquintette von Mozart und Golijov mit David Orlowsky sowie ein Tango-Album mit dem Bandoneonisten Marcelo Nisinman. Die CD „Paris Days – Berlin Nights“ mit Ute Lemper und Stefan Malzew erhielt eine Grammy-Nominierung. Sukzessive entsteht eine Gesamtaufnahme der Dvořák-Quartette für das Label cpo (vier Doppel-CDs sowie das Klavierquintett op. 81 liegen bereits vor).
Anfang 2021 erschienen zwei neue Alben beim Label Capriccio mit Werken von Georgi Catoire (mit Oliver Triendl) und Grigori Frid (mit Elisaveta Blumina). Beide waren für den International Classic Award ICMA nominiert.

studierte bei Hans Deinzer in Hannover, war Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und von 1988 bis 2003 Soloklarinettist der Münchner Philharmoniker sowie Mitglied des Bayreuther Festspielorchesters. Er tritt als Solist auf, ist leidenschaftlicher Kammermusiker und spielte Werke von Reger, Berg, Bartok, Strauss, Molter und Weber für CD ein. Martin Spangenberg war Dozent unter anderem bei „Jeunesses Musicales“ und beim Bundesjugendorchester. Er ist seit 1997 Professor für Klarinette an der Musikhochschule Weimar und seit 2013 Professor an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, wo er von 2015 bis 2019 erster Prorektor war und seit 2019 zudem eine Professur für Bläser-Kammermusik innehat.
