20.00 Uhr
Weihnachtskonzert des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasiums


Konzerthausorchester Berlin
Iván Fischer Dirigent
Chorwerk Ruhr
Anna-Lena Elbert Sopran (Sarada Devi)
Aurélie Franck Alt (First Devotee)
Florian Feth Tenor (Second Devotee)
Krešimir Stražanac Bass („M“)
Konstantin Paganetti Bass (Dr. Sarkar)
Benjamin Glaubitz Tenor
Programm
Philip Glass (*1937)
„Façades“
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
„Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht“ - Kantate für Soli, Chor und Orchester BWV 105
1. Chor: „Herr gehe nicht ins Gericht“
2. Rezitativ: „Mein Gott, verwirf mich nicht“
3. Aria: „Wie zittern und wanken“
4. Rezitativ: „Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß“
5. Aria: „Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen“
6. Choral: „Nun, ich weiß, Du wirst mir stillen“
PAUSE
Philip Glass
„The Passion of Ramakrishna“
Prologue
Part 1: The Master’s Visions
Part 2: Sarada Devi
Part 3: The Master’s Illness
Part 4: The Mahasamadhi of the Master
Epilogue

„Ich finde kein Vergnügen hier bei dieser eitlen Welt in irdischen Sachen“, sagt eine Stimme des heutigen Programms. Ist es der durch und durch fromme Protestant Johann Sebastian Bach, der so spricht? Oder doch der amerikanische Minimalist Philip Glass? Oder stammt die Aussage vielleicht aus dem Mund des indischen Gurus Ramakrishna? Alle Möglichkeiten wären plausibel: Bachs Schaffen gilt ohnehin als der Inbegriff des Überirdischen und Göttlichen; Philip Glass hingegen schockierte die Musikwelt mit der schonungslosen Uneitelkeit seiner Musik, und von Ramakrishna ist überliefert, dass er der Verführung von Geld und später auch der körperlichen Liebe Zeit seines Lebens widerstand.
Tatsächlich finden sich die Worte in der Bach-Kantate „Herr, gehe nicht ins Gericht mit Deinem Knecht.“ Sie beruht auf dem Bibelgleichnis vom unehrlichen Verwalter, in dem Jesus die Menschen dazu auffordert, dem „Mammon“ zu entsagen.
Entsagung – materieller, körperlicher und auch musikalischer Natur – ist ein prägender Aspekt in der auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlich scheinenden Programmzusammenstellung. Belohnt wird sie schlussendlich immer mit Reichtum – sei es in Form von Erleuchtung wie im Falle Ramakrishnas, als Sündenbefreiung und Erlösung, wie sie das Christentum verspricht, oder auch als Erfolg, wie ihn Philip Glass, einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart, erlebt. Wie letzterer gerade durch musikalische „Entsagung“ an diesen Punkt kam, machen Werke wie „Façades“ und „The Passion of Ramakrishna“ heute deutlich.

„Wenn sich herausstellt, dass nichts im üblichen Sinne ‚passiert' […] dann kann er [der Hörer] vielleicht eine andere Art des Hörens entdecken“, war Glass‘ Idee, als er mit Anfang 20 die Minimal Music entwickelte. Zusammen mit drei weiteren amerikanischen Komponisten – Steve Reich, Terry Riley sowie La Monte Young – vollzog er diese radikale Abkehr vom europäisch geprägten Zeitgeist der Avantgarde.
Jenseits des Atlantiks beherrschte nach dem Zweiten Weltkrieg der sogenannte Serialismus das kompositorische Denken. Diese Technik zielte auf eine vollkommene, quasi algorithmische Durchorganisation möglichst aller musikalischen Parameter (Rhythmus, Tonhöhe, Klangfarbe, Lautstärke, Artikulation…). Wiederholungen, herkömmliche Dur- und Molldreiklänge sowie traditionelle Formmodelle waren verpönt. Schon während seiner Studienjahre an der Juilliard School in New York sowie in Paris bei Nadia Boulanger (1887-1979) kam Philip Glass zu der Auffassung, dass diese Komponierweise in eine Sackgasse führte – sowohl für die KomponistInnen als auch für die Hörerschaft. „Das Entscheidende ist nicht, was mit mir passiert, sondern was mit dem Publikum passiert“, war er überzeugt, weshalb er nach einer Musikrichtung suchte, „die nichts, nicht ein einziges Element hätte, was ich studiert hatte.“ Stattdessen bot er nun alles auf, was „nicht erlaubt“ war: etwa immerfort wiederholte Dur- und Molldreiklänge oder den Verzicht auf Expressivität, Dramatik und Entwicklung im herkömmlichen Sinn. Es dauerte einige Jahre, bis das Publikum und die Kritiker bereit waren, sich auf diese oben erwähnte „andere Art des Hörens“, auf die meditative und hypnotische Wirkung dieser Musik einzulassen. Dann war die Erfolgsgeschichte der Minimal Music jedoch nicht mehr aufzuhalten – ihre Einflüsse wirken bis heute tief in verschiedenste Stilrichtungen und Genres, etwa Techno, Elektro, Neoklassik und nicht zuletzt die Filmmusik hinein.

Den seit den 70er-Jahren gebräuchlichen Begriff „Minimal Music“ betrachtete Glass allerdings mit Misstrauen. Er war (wie so oft in der Musikgeschichte) den Bildenden Künsten entlehnt und keineswegs geeignet, die Musikrichtung umfassend abzubilden. So steckte etwa hinter der rhythmischen Organisation seiner Musik keineswegs bloße Reduktion, sondern eine jahrelange Beschäftigung mit der hochkomplexen indischen Musik. „Was mir wie eine Offenbarung erschien, war der Gebrauch des Rhythmus’ bei der Entwicklung der musikalischen Gesamtstruktur. Ich würde den Unterschied im Gebrauch von Rhythmus zwischen westlicher und indischer Musik auf folgende Weise erklären: In der westlichen Musik unterteilen wir die Zeit – als ob man eine bestimmte Länge Zeit nehmen und sie so aufschneiden würde, wie man einen Laib Brot in Scheiben schneidet. In der indischen Musik (und in all der nicht-westlichen Musik, die mir bekannt ist) nimmt man kleine Einheiten, sozusagen „Takte“ und reiht sie aneinander, um größere Zeitwerte zu bilden.“
„Façades“, das zweite Stück der insgesamt sechsteiligen „Glassworks“, entstand im Jahr 1981 und integriert solche östlichen Denkweisen in westliches Komponieren. Ursprünglich als reines Studio-Werk konzipiert, das speziell für das Hören auf Kassetten mittels Walkman abgemischt wurde, zeigte sich auch hier erneut die Bedeutung des Publikums für Glass: „Glassworks […] sollte meine Musik einem breiteren Publikum zugänglich machen, dem meine Arbeit bisher noch nicht vertraut war.“

Eine ähnliche musikgeschichtliche Wende hin zu mehr Einfachheit und Publikumsbezogenheit vollzog sich bereits gut 200 Jahre früher am Übergang vom Barock zur Klassik. Schonungslos deutlich zeigte sich der gewandelte Geschmack etwa in der Abwertung Johann Sebastian Bachs, wie sie in einer Kritik des Publizisten und Komponisten Johann Adolph Scheibe (1708-1776) zum Ausdruck kommt: „Dieser grosse Mann würde die Bewunderung gantzer Nationen sein, wenn er mehr Annehmlichkeit hätte, und wenn er nicht seinen Stücken durch ein schwülstiges und verworrenes Wesen das Natürliche entzöge, und ihre Schönheit durch allzu große Kunst verdunkelte.“ Mit allzu großer Kunst war vor allem die kontrapunktische Satztechnik gemeint, die Bach damals zur höchsten Vollendung führte.
Einen solchen kontrapunktischen Höhenflug unternimmt der sächsische Komponist zum Beispiel in der Fuge des Eröffnungssatzes der heute auf dem Programm stehenden Kantate. Nach einer Art einleitendem Präludium erklingt, anfangs einstimmig, ein neues Thema. Nach und nach, ähnlich wie in einem Kanon, greifen alle Stimmen – strengsten Regeln folgend – dieses Thema auf und „verfolgen“ einander (daher auch der aus dem Lateinischen stammende Begriff fuga – Flucht). Wozu all diese Regeln und all die Mühe? – fragte sich nicht nur J. A. Scheibe. Die „beschwerliche Arbeit“ und „ausnehmende Mühe“ sei ja doch vergebens „weil sie wider die Vernunft streitet“, war seine Ansicht. Offensichtlich entging ihm jedoch, dass all diese kontrapunktischen Kraftanstrengungen bei Bach niemals Selbstzweck sind, sondern stets einer höheren Ordnung folgen.

Musik zur Ehre Gottes zu schreiben, war sicherlich Bachs höchstes Gebot. Im Falle dieser Kantate für den 9. Sonntag nach Trinitatis, die vor kompositorischen Kunststücken geradezu strotzt, rechtfertigt zudem das Libretto die ausgeprägte musikalische Komplexität: „Wie zittern und wanken / Der Sünder Gedanken, / Indem sie sich untereinander verklagen / Und wiederum sich zu entschuldigen wagen. / So wird ein geängstigt Gewissen / Durch eigene Folter zerrissen“, heißt es in der Sopranarie. Entsprechend spannungsgeladen und dissonanzenreich ist auch die Musik. Die schmerzliche Folter kann hier in den herben Seufzern der Oboe und des Gesangs vernommen werden, das angstvolle Erzittern in den Streichern und der Verlust eines festen Halts in Bachs Verzicht auf die Bassinstrumente.

Die expressive Kraft, mit denen Bach dem Text des heute unbekannten Librettisten im Jahr 1723 Leben einhauchte, ließ seinerzeit wohl tatsächlich den ein oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin erzittern. Gerade in Leipzig, damals eine der wichtigsten Handelsstädte Deutschlands, war das Thema Geld und der Umgang mit Schulden und Schuldnern sicherlich nicht unheikel. „Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen, / So gilt der Mammon nichts bei mir“, heißt es in der schwungvollen Tenorarie – Worte, die im Alltag mancher Leipziger Kaufleute wohl etwas theoretisch klangen ... Zum Glück verspricht der Choral am Ende der Kantate Erlösung von allen Sünden und aller Anhaftung an den schnöden Mammon: „Es wird deine Treu erfüllen, / Was du selber hast gesagt: / Dass auf dieser weiten Erden / Keiner soll verloren werden, / Sondern ewig leben soll, / Wenn er nur ist Glaubens voll.“ Die allmähliche Beruhigung, welche die angstvolle Seele im Schlusschor erfährt, illustriert Bach auf ungewöhnliche und fast futuristische Weise: Zu Beginn „zittern“ die Begleitfiguren noch in raschen Sechzehnteln, bevor sie in Triolen, dann Achtel und schließlich in vertrauensselige Viertel übergehen.
Mit all diesen kunstvollen Details und der bildhaften Expressivität scheint Bachs Kantate auf den ersten Blick in völligem Kontrast zur Musik Philip Glass’ zu stehen. Doch nicht nur der rhythmische Perpetuum mobile-Charakter vieler Generalbässe verbindet den sächsischen Protestanten mit dem New Yorker Sohn eines Schallplattenhändlers. Dramatische Ausdruckskraft und Opulenz waren mit fortschreitenden Jahren auch Glass immer weniger fremd – wie sein Oratorium „The Passions of Ramakrishna“ zeigt.
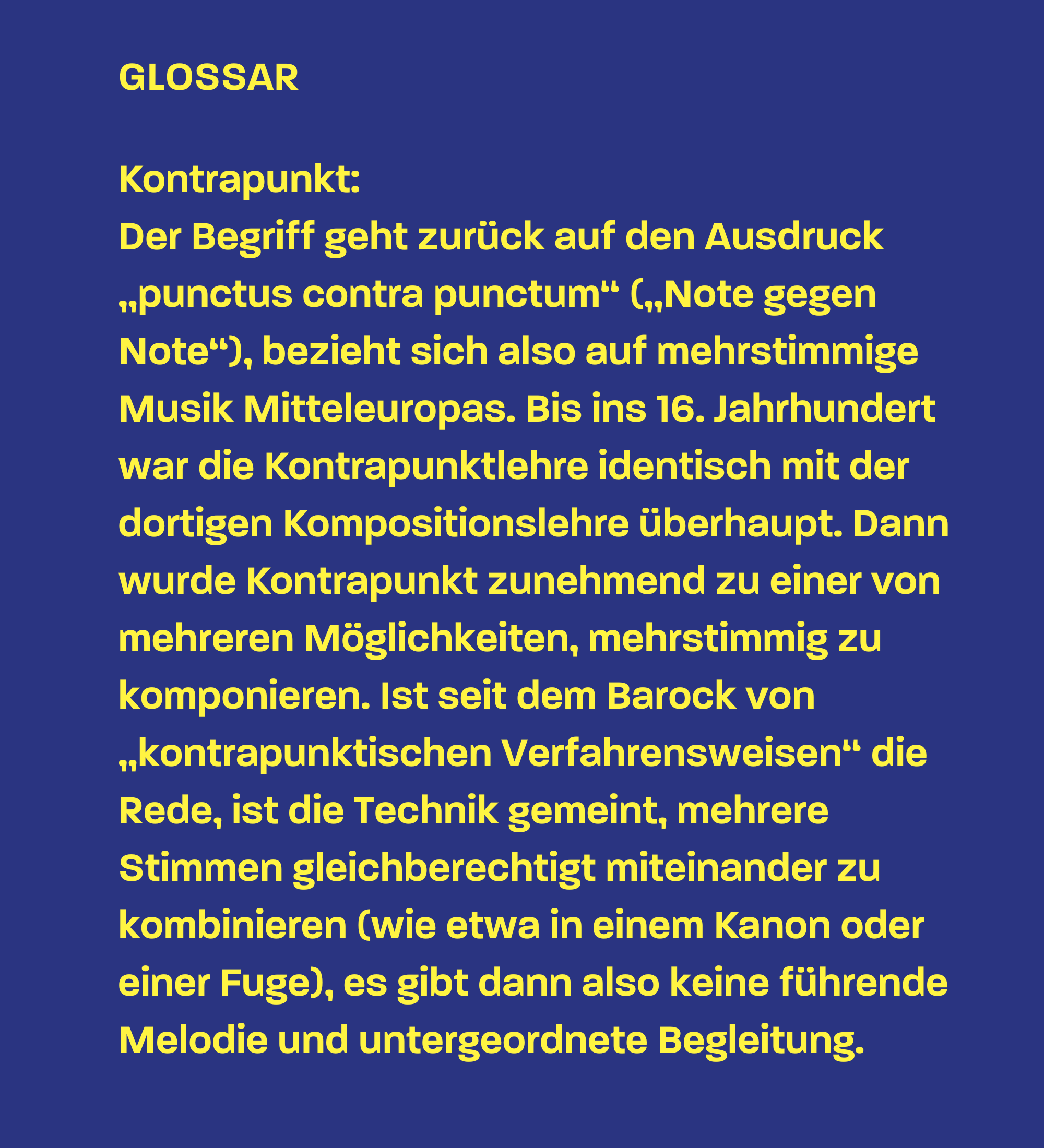 zurück
zurück

Wie bei Bach, mündet auch in Glass’ 2006 uraufgeführtem Oratorium das irdische Leiden schließlich in Erlösung. „And I shall dance around you and clap my hands of joy“ („Und ich werde um dich herum tanzen und vor Freude in die Hände klatschen“), heißt es im Epilog des sechssätzigen Stückes. Adressiert sind diese Worte an die Göttin Kali, die Ramakrishna (1836-1886) als göttliche Mutter verehrte. Ihr gelten seine letzten Worte im Moment seiner Sterbestunde, die im Libretto Kusumita P. Pedersens ausführlich beschrieben ist. Basierend auf der Schrift „Gospel of Sri Ramakrishna“ kommt darin neben Ramakrishna selbst auch seine Frau Sarada Devi zur Sprache, ebenso wie der Arzt Dr. Sarkar, sein Anhänger „M.“ (mit vollem Namen Mahendranath Gupta; er verfasste später, basierend auf seinen Aufzeichnungen, die Schrift „Gospel of Sri Ramakrishna“), sowie zwei weitere namenlose Personen. Ramakrishna selbst stellt Glass jeweils durch den vollen, vierstimmigen Chor dar. In gänzlichem Kontrast zu den Fugen und polyphonen Verwebungen bei Bach singen die vier Stimmen des Chors hier fast immer syllabisch (d. h. jeweils eine Silbe pro Ton) und homorhythmisch (alle vier Stimmen haben denselben Rhythmus inne); dadurch gewährt Glass eine maximale Textverständlichkeit.

Selbst im Moment größter Schmerzen – Ramakrishna starb mit 50 Jahren an Kehlkopfkrebs – vermochte es der hinduistische Mystiker, sein körperliches Leiden zu transzendieren und die Einheit mit Gott aufrecht zu erhalten. Gott war für ihn keine exklusive Figur des Hinduismus, sondern eine übergeordnete Wahrheit, die allen Religionen gleichermaßen zu eigen war. Mit dieser damals ausgesprochen fortschrittlichen Haltung löste er eine tiefgreifende Bewegung in Indien aus, die sich nicht zuletzt durch Mahatma Gandhi fortsetzte.
„Es ist schwer vorstellbar, dass Indien ohne den Funken, der von Ramakrishnas Brillanz ausging, auf der Weltbühne aufgetaucht wäre“, schrieb Glass in den Notizen zu seinem Oratorium. Zu seiner eigenen Religiosität sagte der jüdisch geborene und atheistisch aufgewachsene Glass in einem Interview anlässlich seines 80. Geburtstags: „Ich bin genauso bekennender Buddhist wie bekennender Tolteke, bekennender Hindu oder sogar Katholik. Ich bin nicht Mitglied in einem Klub, sondern in vielen Klubs.“
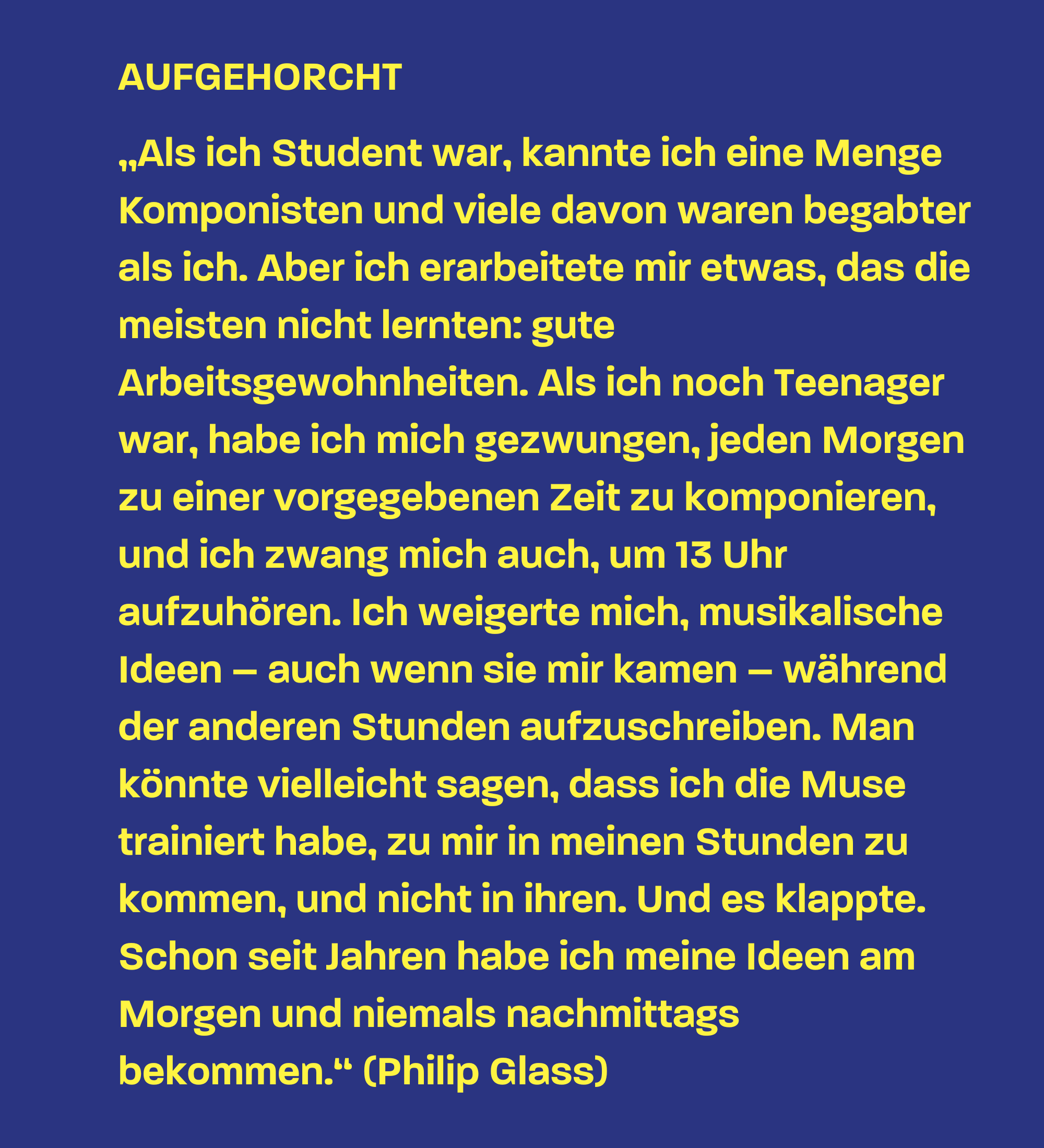



Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.
1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.
Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Iván Fischer, von 2012 bis 2018 Chefdirigent des Konzerthausorchesters und heute dessen Ehrendirigent, ist als einer der visionärsten Musiker unserer Zeit bekannt.
Mit dem Budapest Festival Orchestra, das er Mitte der 80er Jahre gründete, hat er zahlreiche Reformen eingeführt und etabliert. Mit Tourneen und einer Serie von Aufnahmen für Philips Classics und Channel Classics erwarb er sich den Ruf als einer der meist gefeierten Orchesterleiter der Welt.
Er rief mehrere Festivals ins Leben, darunter das Budapester Mahler-Fest, das „Bridging Europe“ Festival und das Vicenza Opera Festival. Das Weltwirtschaftsforum verlieh ihm den Crystal Award für seine Verdienste zur Förderung internationaler kultureller Beziehungen.
Er war Chefdirigent des National Symphony Orchestra in Washington und der Opéra National de Lyon. Ebenso ist er Honorary Guest Conductor des Royal Concertgebouw Orchestra, mit dem ihn eine jahrzehntelange Zusammenarbeit verbindet.
Iván Fischer studierte Klavier, Violine und Violoncello in Budapest, ehe er in Wien die legendäre Dirigierklasse von Hans Swarowsky besuchte. Nach einer zweijährigen Assistenzzeit bei Nikolaus Harnoncourt startete er seine internationale Karriere mit dem Sieg beim Dirigentenwettbewerb der Rupert Foundation in London.
Er gründete die Ivan Fischer Opera Company, mit der er unabhängige Opernproduktionen verwirklicht. Die Produktionen der IFOC wurden in New York, Edinburgh, Abu Dhabi, Berlin, Genf und Budapest gefeiert.
Seit 2004 ist Ivan Fischer auch als Komponist tätig. Seine Oper „Die rote Färse“ hat in der ganzen Welt für Schlagzeilen gesorgt; die Kinderoper „Der Grüffelo“ erlebte in Berlin mehrere Wiederaufnahmen; seine „Deutsch-Jiddische Kantate“ wurde in zahlreichen Ländern aufgeführt und aufgenommen.
Iván Fischer ist Gründer der Ungarischen Mahler-Gesellschaft und Schirmherr der Britischen Kodály Academy. Der Präsident der Republik Ungarn hat ihn mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet, die französische Regierung ernannte ihn zum Chevalier des Arts et des Lettres. 2006 wurde er mit dem ungarischen Kossuth-Preis geehrt, 2011 erhielt er den Royal Philharmonic Society Music Award und den Dutch Ovatie Prize, 2013 wurde er zum Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London ernannt. Er ist Ehrenbürger von Budapest.
Das 1999 gegründete Vokalensemble entwickelte sich zu einer festen Säule der Vokalkunst im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung fanden Konzerte mit Musik aus allen Epochen bis zur Gegenwart statt in Zusammenarbeit mit Dirigentinnen und Dirigenten wie George Benjamin, Frieder Bernius, Sylvain Cambreling, Reinhard Goebel, Susanna Mälkki, Kent Nagano, Marcus Stenz, Bruno Weil und Hans Zender. In Konzerten mit Orchestern wie der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, den Berliner Philharmonikern, Concerto Köln, Ensemble Resonanz und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks begeistert Chorwerk Ruhr immer wieder sein Publikum. Häufige Aufnahmen durch WDR und DLF sowie die Teilnahme an nationalen und internationalen Musikfestivals spiegeln die Beliebtheit des Ensembles wider. Als Mitglied des Tenso-Netzwerks arbeitet der Chor auf organisatorischer Ebene regelmäßig mit professionellen Kammerchören in ganz Europa zusammen. Alljährlich kooperiert Chorwerk Ruhr in besonderer Form mit der „Ruhrtriennale“. Chorwerk Ruhr ist ein Bestandteil der Kultur Ruhr GmbH, gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
Die Münchner Sopranistin schloss ihr Gesangsstudium an der HMT München mit einem Master in Liedgestaltung ab. Sie gibt Konzerte mit einem Repertoire von der Renaissance bis zur Moderne und musiziert dabei mit renommierten Orchestern in Deutschland, dem Sinfonieorchester Porto und dem Budapest Festival Orchestra. Sie war Stipendiatin des MozartLabors im Rahmen des Mozartfestes Würzburg und beim Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Rheingau Festival, dem Beethovenfest Bonn, dem Bachfest Leipzig sowie musica viva in München zu erleben. Ihr Opernrepertoire umfasst Partien wie Adele („Die Fledermaus“), Adina („L’elisir d’amore), Norina („Don Pasquale“), Pamina und Königin der Nacht („Die Zauberflöte“). Anna-Lena Elbert ist regelmäßig Gast bei den Opernfestspielen Heidenheim. Im Mai 2022 debütierte sie bei den Salzburger Festspielen. Sie hegt eine besondere Leidenschaft für Kammermusik und Liedgestaltung. 2019 wurde sie gemeinsam mit Kota Sakaguchi Preisträgerin des Richard Strauss Liedwettbewerbs sowie des internationalen Helmut Deutsch Liedwettbewerbs und gibt regelmäßig Liederabende, unter anderem bei der Schubertíada in Spanien.
Die belgische Mezzosopranistin Aurélie Franck studierte gleichzeitig Gesang am Konservatorium und Theaterregie an der INSAS in Brüssel. Nach ihrem Debüt beim Opernfestival Schloss Rheinsberg als Nerone und der Königlichen Oper Walloniens als Pamina folgten Rollen und Konzerte an der Oper Versailles, in der Essener Philharmonie, bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, den Händel Festspielen in Halle und dem Beethovenfest Bonn. Höhepunkte ihrer Karriere beinhalten unter anderem „Grand Pianola Music“ von John Adams mit dem Ensemble Asko/Schoenberg unter dem Dirigat von Reinbert de Leeuw im Concertgebouw Amsterdam, eine Auszeichnung für die beste CD-Aufnahme „Fragments“ mit unveröffentlichten Werken von C. Ledoux, eine Uraufführung unter der Leitung von Sir Simon Rattle in der Berliner Philharmonie und ein Programm, das C. Vivier gewidmet wurde unter dem Dirigat von Vladimir Jurowski im Konzerthaus Berlin.
Florian Feth begann sein Gesangsstudium 2005 in Mainz. Ab 2010 studierte er bei Thomas Heyer an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, wo er im Sommer 2012 sein Diplom erhielt. Weitere Studien führten ihn unter anderem zu Helmut Deutsch und Gerd Türk. Engagements führten ihn an das Theater Koblenz und die Oper Frankfurt. 2013 war er in Vykintas Baltakas' „Cantio“ im Konzerthaus Berlin zu hören. Im Mai 2014 sang er die „Himmelsstimme Tenor“ in de Cavalieris „Rappresentatione di Anima et di Corpo“ an der Staatsoper Berlin unter Leitung von René Jacobs. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Konzertgesang, besonders im barocken und klassischen Repertoire. Er singt in Ensembles wie dem Amsterdam Baroque Choir (Ton Koopman), dem Vocalconsort Berlin und dem RIAS Kammerchor.
Der kroatische Bassbariton wurde mit 24 Jahren für einige Spielzeiten festes Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich. In der Saison 2021/2022 gab er sein Debüt mit der Titelpartie des Orpheus (Telemanns „Orpheus“) unter der Leitung von René Jacobs in einer Europa-Tournee. Ein Höhepunkt der Saison 2022/2023 war das Engagement als Ambrosio (Carl Maria von Webers „Die drei Pintos“) mit dem Gewandhausorchester zu Leipzig. Als Konzertsolist steht Krešimir Stražanac regelmäßig mit Werken von Barock bis zur zeitgenössischen Musik bei Spitzenorchestern in Europa und Fernost auf dem Podium. 2022 debütierte er unter Masaaki Suzuki beim Bach Festival in Montréal. Bedeutend für seinen musikalischen Werdegang ist die Zusammenarbeit mit Philippe Herreweghe sowie dem Concertgebouw Orchestra Amsterdam, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Sächsischen Staatskapelle Dresden. 2023 gab er sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Kirill Petrenko.
Konstantin Paganetti, 1996 in Neuwied am Rhein geboren, studierte Gesang bei Christoph Prégardien in Köln und aktuell im Konzertexamen bei Thilo Dahlmann in Frankfurt. Der Preisträger verschiedener Wettbewerbe erhielt Konzerteinladungen zum Rhone Festival für Liedkunst, zum Festival „im zentrum lied“ Köln, dem Festival für Alte Musik Knechtsteden, in den Kammermusiksaal des Beethovenhauses Bonn, zu den Aachener Bachtagen, den Wittener Tagen für neue Kammermusik, vom Bachfest Schaffhausen und in die Kölner Philharmonie. In der Saison 2023/24 ist er Stipendiat der deutschen Orchesterstiftung. Zu seinen musikalischen Partner*innen gehören Christoph Prégardien, Moritz Eggert, Christoph Schnackertz, Franziska Staubach, Toni Ming Geiger, Anastasia Grishutina, Andreas Frese, Hedayet Djeddikar, Eric Schneider und Michael Gees.
absolvierte sein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik in Dresden bei Margret Trappe-Wiel und in der Meisterklasse bei KS Olaf Bär. Er musizierte mit zahlreichen Ensembles und Orchestern. Konzerte der jüngeren Vergangenheit waren ein Liederabend in der Semperoper Dresden, eine Tournee mit Bachs Matthäus-Passion mit Justin Doyle, dem RIAS Kammerchor und der Akademie für Alte Musik Berlin in der Berliner Philharmonie, im Concertgebouw Amsterdam und der Philharmonie Essen, ein Konzert mit Martha Argerich in der Elbphilharmonie Hamburg unter der Leitung von Sylvain Cambreling und Bachs h-Moll-Messe in der Inszenierung von John Neumeier an der Hamburgischen Staatsoper. Konzerte als Solist oder mit Ensembles wie Collegium Vocale Gent führten ihn in europäische, asiatische und süd- und nordamerikanische Musikzentren.

